|
Zirkulationsarbeit und Zirkulationskosten
1. Zirkulation
und Produktion im Kreislauf des Kapitals „Das
Kapital als sich verwertender Wert umschließt nicht nur
Klassenverhältnisse, einen bestimmten gesellschaftlichen Charakter,
der auf dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit ruht. Es ist eine
Bewegung, ein Kreislaufprozess durch verschiedene Stadien, der selbst
wieder drei verschiedene Formen des Kreislaufprozesses einschließt. Es
kann daher nur als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen
werden.“ K.
Marx, Kapital II, MEW 24, 109. „Der
Kreislaufprozess des Kapitals geht vor sich in drei Stadien, welche, nach
der Darstellung des ersten Bandes, folgende Reihe bilden:
Erstes
Stadium: Der
Kapitalist erscheint auf dem Warenmarkt und Arbeitsmarkt als Käufer; sein
Geld wird in Ware umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt G – W
durch. Zweites
Stadium:
Produktive Konsumtion der gekauften Waren durch den Kapitalisten. Er
wirkt als kapitalistischer Warenproduzent; sein Kapital macht den
Produktionsprozess durch. Das Resultat ist: Ware von mehr Wert als dem
ihrer Produk-tionselemente. Drittes
Stadium: Der
Kapitalist kehrt zum Markt zurück als Verkäufer; seine Ware wird in Geld
umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt W – G durch.“ K. Marx,
Kapital II, MEW 24, 31. „Nur in
der Einheit der drei Kreisläufe ist die Kontinuität des Gesamtprozesses
verwirklicht ... Das gesellschaftliche Gesamtkapital besitzt stets diese
Kontinuität, und ... sein Prozess besitzt stets die Einheit der drei
Kreisläufe.“ K. Marx,
Kapital II, MEW 24, 108f. „Die
Zirkulation ist ebenso notwendig bei der Warenproduktion wie die
Produktion selbst, also die Zirkulationsagenten ebenso nötig wie die
Produktionsagenten.“ K. Marx,
Kapital II, MEW 24, 129.
Grafik:
Kreislauf des Kapitals 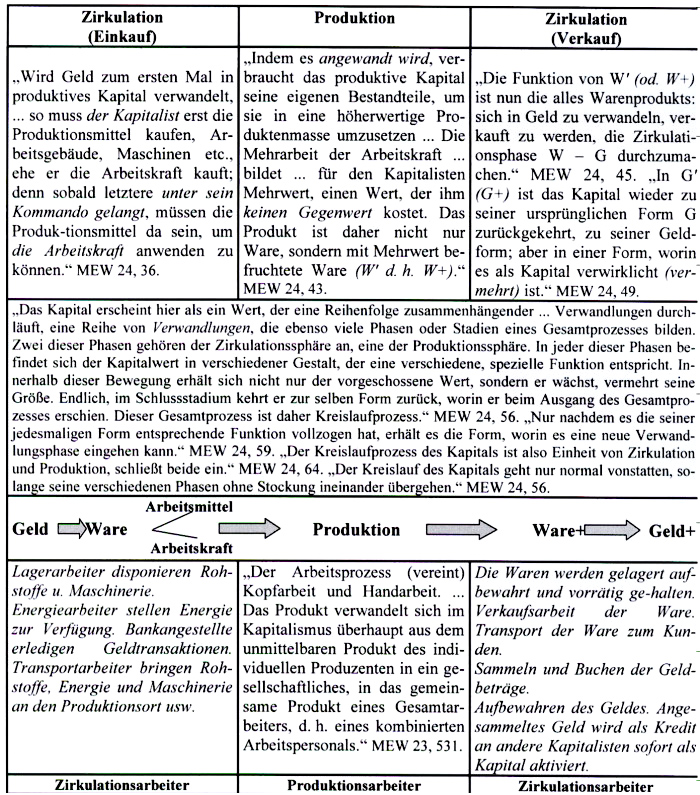
2. Kosten der
Zirkulation 2.1. Kaufmännische
Zirkulationskosten „Bei dem
Kaufmannskapital haben wir es ... mit einem Kapital zu tun, das am
Profit teilnimmt, ohne an seiner Produktion teilzunehmen. Es ist also
jetzt nötig, die frühere Darstellung zu ergänzen.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 295. „Wie das industrielle
Kapital nur Profit realisiert, der als Mehrwert schon im Wert der Ware
steckt, so das Handelskapital nur, weil der ganze Mehrwert oder Profit
noch nicht realisiert ist in dem vom industrielle Kapital realisierten
Preis der Ware. Der Verkaufspreis des
Kaufmanns steht so über dem Einkaufspreis, ... weil dieser unter dem
Totalwert steht.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 297. „In der ergänzenden
Ausgleichung der Profite durch die Dazwischenkunft des Kaufmannskapitals
zeigte sich, dass in den Wert der Ware kein zusätzliches Element eingeht
für das vorgeschossene Geldkapital des Kaufmanns, dass der Zuschlag auf
den Preis, wodurch der Kaufmann seinen Profit macht, nur gleich ist dem
Wertteil der Ware, den das produktive Kapital im Produktionspreis der Ware
nicht berechnet ... hat.“ K. Marx, Kapital
III, MEW 25, 298. „Dies ist jedoch nur
richtig, wenn wie bisher angenommen wird, dass der Kaufmann keine Unkosten
hat oder dass er außer dem Geldkapital, das er vorschießen muss, ... kein
anderes Kapital, zirkulierendes oder fixes, im Prozess ... des Kaufens und
Verkaufens vorzuschießen hat. Dem ist jedoch nicht so, wie man gesehen hat
bei Betrachtung der Zirkulationskosten (Buch II, Kap. VI).“
K. Marx,
Kapital III, MEW 25, 299. „Welcher Art immer
diese Zirkulationskosten sein mögen; ob sie aus dem rein kaufmännischen
Geschäft als solchem entspringen, also zu den spezifischen
Zirkulationskosten des Kaufmanns gehören; oder ob sie Posten vorstellen,
die aus nachträglichen, innerhalb des Zirkulationsprozesses hinzukommenden
Produktionsprozessen, wie Spedition, Transport, Aufbewahrung etc.
entspringen: sie unterstellen auf der Seite des Kaufmanns, außer
dem im Warenkauf vorgeschossenen Geldkapital, stets ein zusätzliches
Kapital, das in Ankauf und Zahlung dieser Zirkulationsmittel vorgeschossen
war. Soweit dies
Kostenelement aus zirkulierendem Kapital besteht, geht es ganz, soweit aus
fixem Kapital, geht es nach Maßgabe seines Verschleißes als Zusatzelement
in den Verkaufspreis der Waren ein; ... Ob aber zirkulierend
oder fix, dies ganze zusätzliche Kapital geht ein in die Bildung der
allgemeinen Profitrate.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 299. „Die rein
kaufmännischen Zirkulationskosten (also mit Ausschluss der Kosten für
Spedition, Transport, Aufbewahrung etc.) lösen sich auf in die Kosten, die
nötig sind, um den Wert der Ware zu realisieren, ihn, sei es aus Ware in
Geld oder aus Geld in Ware zu verwandeln, ... Alles dies findet sich
im eigentlichen Großhandel, wo das kaufmännische Kapital am reinsten und
am wenigsten verquickt mit anderen Funktionen erscheint.
... Die Kosten, die wir
hier betrachten, sind die des Kaufens und die des Verkaufens. Es ist schon
früher bemerkt worden, dass sie sich auflösen in Rechnen, Buchführen,
Markten, Korrespondenz etc. Das konstante Kapital, das dazu erforderlich ist, besteht in Kontor, Papier, Porto etc. Die anderen Kosten lösen sich auf in variables Kapital, das in Anwendung kaufmännischer Lohnarbeiter vorgeschossen wird. ... Diese sämtlichen Kosten werden nicht gemacht in der Produktion des Gebrauchswerts der Waren, sondern in der Realisation ihres Werts; sie sind reine Zirkulationskosten. Sie gehen nicht ein in den unmittelbaren Produktionsprozess, aber in den Zirkulationsprozess, daher in den Gesamtprozess der Reproduktion.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 299f.
2.2.
Zirkulationskosten durch den Geldverkehr „Ein bestimmter Teil
des Kapital muss beständig als Schatz, potenzielles Geldkapital, vorhanden
sein: Reserve von Kaufmitteln, Reserve von Zahlungsmitteln,
unbeschäftigtes, in Geldform seiner Anwendung harrendes Kapital; und ein
Teil des Kapitals strömt beständig in dieser Form zurück. Dies macht,
außer Einkassieren, Zahlen und Buchhalten, Aufbewahrung des Schatzes
nötig, was wieder eine besondere Operation ist. Es ist also in der Tat die beständige Auflösung des Schatzes in Zirkulationsmittel und Zahlungsmittel und seine Rückbildung aus im Verkauf erhaltenem Geld und fällig gewordener Zahlung; diese beständige Bewegung des als Geld existierenden Teils des Kapitals, getrennt von der Kapitalfunktion selbst, diese rein technische Operation ist es, die besondere Arbeit und Kosten verursacht – Zirkulations-kosten.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 328. „Die Teilung der
Arbeit bringt es mit sich, dass diese technischen Operationen, die durch
die Funktionen des Kapital bedingt sind, soweit wie möglich für die ganze
Kapitalistenklasse von einer Abteilung von Agenten oder Kapitalisten als
ausschließliche Funktionen verrichtet werden oder sich in ihren Händen
konzentrieren. Es ist hier, wie beim
Kaufmannskapital, Teilung der Arbeit in doppeltem Sinn. Es wird besonderes
Geschäft, und weil es als besonderes Geschäft für den Geldmechanismus der
ganzen Klasse verrichtet wird, wird es konzentriert auf großer
Stufenleiter ausgeübt; und nun findet wieder Teilung der Arbeit innerhalb
dieses besonderen Geschäfts statt, sowohl durch Spaltung in verschiedene
voneinander unabhängige Zweige, wie durch Ausbildung des
Einzelbetriebs innerhalb dieser Zweige (große Büros, zahlreiche
Buchhalter und Kassierer, weit getriebene
Arbeitsteilung). Auszahlung des Geldes,
Einkassierung, Ausgleichung der Bilanzen, Führung laufender Rechnungen,
Aufbewahren des Geldes etc., getrennt von den Akten, wodurch diese
technischen Operationen nötig werden, machen das in diesen Funktionen
vorgeschossene Kapital zum Geldhandlungskapital (= Bankkapital).“
K. Marx,
Kapital III, MEW 25, 328f. „Die verschiedenen
Operationen, aus deren Verselbständigung zu besonderen Geschäften der
Geldhandel entspringt, ergeben sich aus den verschiedenen Bestimmtheiten
des Geldes selbst und aus seinen Funktionen, die also auch das Kapital in
der Form von Geldkapital durchzumachen hat.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 329. „Ich habe früher
darauf hingewiesen, wie das Geldwesen überhaupt sich ursprünglich
entwickelt im Produktenaustausch zwischen verschiedenen Gemeinwesen. Es
entwickelt sich der Geldhandel, der Handel mit der Geldware, daher
zunächst aus dem internationalen Verkehr. Sobald verschiedene Landesmünzen
existieren, haben die Kaufleute, die in fremden Ländern einkaufen, ihre
Landesmünze in die Lokalmünze umzusetzen, und umgekehrt oder auch
verschiedene Münzen gegen ungemünztes reines Silber oder Gold als
Weltgeld. Daher das Wechselgeschäft, das als eine der naturwüchsigen
Grundlagen des modernen Geldhandels zu betrachten ist.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 329. „Wie die ganze
Geldzirkulation in ihrem Umfang, ihren Formen und ihren Bewegungen bloßes
Resultat der Warenzirkulation ist, die vom kapitalistischen Standpunkt aus
selbst nur den Zirkulationsprozess des Kapitals darstellt (...), so
versteht es sich ganz von selbst, dass der Geldhandel nicht ... die
Geldzirkulation vermittelt. Diese Geldzirkulation
selbst, als ein Element der Warenzirkulation, ist für ihn gegeben.
Was er vermittelt, sind ihre technischen Operationen, die er konzentriert,
abkürzt und vereinfacht.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 333. „Der Geldhandel bildet
nicht die Schätze, sondern liefert die technischen Mittel, um diese
Schatzbildung, soweit sie freiwillig ist (also nicht Ausdruck von
unbeschäftigtem Kapital oder von Störung des Reproduktionsprozesses), auf
ihr ökonomisches Minimum zu reduzieren, indem die Reservefonds für Kauf-
und Zahlungsmittel, wenn sie für die ganze Kapitalistenklasse
verwaltet werden, nicht so groß zu sein brauchen, als wenn
sie von jedem Kapitalisten besonders verwaltet
werden. Der Geldhandel kauft
nicht die edlen Metalle, sondern vermittelt nur ihre Verteilung, sobald
der Warenhandel sie gekauft hat. Der Geldhandel
erleichtert die Ausgleichung der Bilanzen, soweit das Geld als
Zahlungsmittel fungiert, und vermindert durch den ... Mechanismus dieser
Ausgleichungen die dazu nötige Geldmasse; aber er bestimmt weder
den Zusammenhang noch den Umfang der wechselseitigen Zahlungen.
... Soweit das Geld als
Kaufmittel zirkuliert, sind Umfang und Anzahl der Käufe und Verkäufe
durchaus unabhängig vom Geldhandel. Er kann nur die technischen
Operationen, die sie begleiten, verkürzen, und dadurch die Masse des zu
ihrem Umschlag nötigen baren Geldes vermindern.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 333f. „Der Geldhandel in der
reinen Form, worin wir ihn hier betrachten, d. h. getrennt vom
Kreditwesen, hat es also nur zu tun mit der Technik eines Moments der
Warenzirkulation, nämlich der Geldzirkulation und den daraus
entspringenden verschiedenen Funktionen des Geldes.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 334. „Dies unterscheidet
den Geldhandel wesentlich vom Warenhandel, der die Verwandlung der
Ware und den Warenaustausch vermittelt oder selbst diesen Prozess des
Warenkapitals als Prozess eines vom industriellen Kapital gesonderten
Kapitals erscheinen lässt. Wenn daher das Warenhandlungskapital eine
eigene Form der Zirkulation zeigt, G – W – G, wo die Ware zweimal die
Stelle wechselt und dadurch das Geld zurückfließt, ... so kann keine
solche besondere Form für das Geldhandlungskapital nachgewiesen werden.“
K. Marx,
Kapital III, MEW 25, 334. „Soweit Geldkapital in dieser technischen Vermittlung der Geldzirku-lation von einer besonderen Abteilung Kapitalisten vorgeschossen wird ..., ist die allgemeine Form des Kapitals G – G' auch hier vorhanden. ... Aber die Vermittlung von G – G' bezieht sich hier nicht auf die sachlichen, sondern nur auf die technischen Momente der Verwandlung.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 334.
2.3.
Zirkulationskosten durch Versicherung „Ganz
verschieden, sowohl vom Ersatz des Verschleißes wie von den Arbeiten der
Erhaltung und Reparatur ist die Versicherung, die sich auf
Zerstörung durch außerordentliche Naturereignisse, Feuersbrunst,
Überschwemmungen etc. bezieht. Diese muss aus dem Mehrwert gutgemacht
werden und bildet einen Abzug von demselben. Oder, vom Standpunkt der
ganzen Gesellschaft betrachtet: Es muss eine beständige Überproduktion
stattfinden, d. h. Produktion auf größerer Stufenleiter, als zu einfachem
Ersatz und Reproduktion des vorhandenen Reichtums nötig – ganz
abgesehen von Zunahme der Bevölkerung –, um die Produktionsmittel zur
Verfügung zu haben, zur Ausgleichung der außerordentlichen
Zerstörung, welche Zufälle und Naturkräfte anrichten.“ K. Marx, Kapital
II, MEW 24, 178. „Eine
ganze Reihe laufender Unkosten bleibt sich beinahe oder ganz gleich bei
längerem wie bei kürzerem Arbeitstag. Die Aufsichtskosten sind geringer
für 500 Arbeiter bei 18 Arbeitsstunden als für 750 bei 12 Stunden. ...
Staats- und Gemeindesteuern, Feuerversicherung, Lohn verschiedener
ständiger Angestellter, Entwertung der Maschinerie und verschiedene andere
Unkosten einer Fabrik laufen unverändert voran bei langer oder kurzer
Arbeitszeit; ...“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 88. „Ferner:
Sobald die kapitalistische Produktion einen gewissen Entwicklungsgrad
erreicht hat, geht die Ausgleichung zwischen den verschiedenen Profitraten
der einzelnen Sphären zu einer allgemeinen Profitrate keineswegs bloß noch
vor sich durch das Spiel der Attraktion und Repulsion, worin die
Marktpreise Kapital anziehen oder abstoßen. Nachdem
sich die Durchschnittspreise und ihnen entsprechende Marktpreise für eine
Zeitlang befestigt haben, tritt es in das Bewusstsein der einzelnen
Kapitalisten, dass in dieser Ausgleichung bestimmte Unterschiede
ausgeglichen werden, so dass sie dieselben gleich in ihrer wechselseitigen
Berechnung einschließen. In der
Vorstellung der Kapitalisten leben sie und werden von ihnen in Rechnung
gebracht als Kompensationsgründe.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 219. „Die
Grundvorstellung dabei ist der Durchschnittsprofit selbst, die
Vorstellung, dass Kapitale von gleicher Größe in denselben Zeitfristen
gleich große Profite abwerfen müssen. Ihr liegt wieder die Vorstellung
zugrunde, dass das Kapital jeder Produktionssphäre nach Anteil seiner Größe
teilzunehmen hat an dem von dem gesellschaftlichen Gesamtkapital den
Arbeitern ausgepressten Gesamtmehrwert; oder dass jedes besondere
Kapital nur als Stück des Gesamtkapitals, jeder Kapitalist in der Tat als
Aktionär in dem Gesamtunternehmen zu betrachten ist, der nach Anteil der Größe seines
Kapitalanteils am Gesamtprofit sich beteiligt.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 219f. „Auf
diese Vorstellung stützt sich dann die Berechnung des Kapitalisten, z. B.
dass ein Kapital, welches langsamer umschlägt, weil entweder die Ware
länger im Produk-tionsprozess verharrt oder weil sie auf entfernten
Märkten verkauft werden muss, den Profit, der ihm dadurch entgeht, dennoch
anrechnet, sich also durch Aufschlag auf den Preis
entschädigt. Oder
aber, dass Kapitalanlagen, die größeren Gefahren ausgesetzt sind, wie z.
B. in der Reederei, eine Entschädigung durch Preisaufschlag
erhalten. Sobald die kapitalistische Produktion, und mit ihr das Versicherungs-wesen entwickelt ist, ist die Gefahr in der Tat für alle Produktions-sphären gleich groß (...); die gefährdeteren zahlen aber die höhere Versicherungsprämie und erhalten sie im Preis ihrer Waren vergütet.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 220.
3. Zirkulationsarbeit
schafft zwar keinen Mehrwert, vergrößert aber den
gesellschaftlichen Gesamtprofit 3.1. „Man hat in Buch II
gesehen, dass die reinen Funktionen des Kapitals in der Zirkulation – ...
also die Akte des Verkaufens und Kaufens – weder Wert noch Mehrwert
erzeugen. Umgekehrt zeigte es sich, dass die Zeit, die hierfür nötig
ist, objektiv mit Bezug auf die Waren und subjektiv mit Bezug auf den
Kapitalisten, Grenzen erzeugt für die Bildung von Wert und
Mehrwert. Was von der
Verwandlung des Warenkapitals an sich gilt, wird natürlich in
keiner Weise dadurch geändert, dass ein Teil desselben die Gestalt des
Warenhandlungskapital annimmt ...“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 292. „... Wenn dies
Geldkapital weder Wert noch Mehrwert schafft, so kann es diese
Eigenschaften nicht dadurch erwerben, dass es, statt vom industriellen
Kapitalisten, von einer anderen Abteilung Kapitalisten zur Verrichtung
derselben Funktionen beständig in Zirkulation geworfen wird.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 292. 3.2.
Das alles ist
weitgehend bekannt und unbestritten. Vielen Marxisten ist jedoch – wie
Ricardo – unbekannt, „dass Ursachen den
Profit erhöhen oder erniedrigen, überhaupt beeinflussen können,
wenn der Mehrwert gegeben ist ...“. K. Marx, Theorien über
den Mehrwert II, MEW 26.2, 378. „Die Zirkulationskosten
als solche, d. h. die durch die Operation des Austauschs und durch eine
Reihe von Austauschoperationen verursachte Konsumtion von Arbeitszeit oder
... Werten, sind ... Abzug entweder von der auf die Produktion verwandten
Zeit, oder von den durch die Produktion gesetzten Werten. Sie können nie
den Wert vermehren. Sie gehören zu den toten Kosten der ... auf dem
Kapital beruhenden Produk-tion. ...
Jedoch: Insofern das
Kaufmannsgeschäft und noch mehr das eigentliche Geldgeschäft diese
toten Kosten vermindern, fügen sie der Produktion zu, nicht dadurch, dass
sie Wert schaffen, sondern die Negation der geschaffenen Werte vermindern.
... Befähigen sie die
Produzenten mehr Werte zu schaffen, als sie ohne diese Teilung der Arbeit
könnten, und zwar so viel mehr, dass ein Mehr bleibt nach Bezahlung
dieser Funktion, so haben sie faktisch die Produktion vermehrt. Die Werte
sind dann aber vermehrt, nicht weil die Zirkulationsoperationen Wert
geschaffen, sondern weil sie weniger Wert absorbiert haben, als sie im
anderen Fall getan hätten.“ K.
Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
526f. „Im Übrigen muss
angenommen werden, dass mit der Teilung zwischen kaufmännischem und
industriellem Kapital Zentralisation der Handelskosten und daher
Verringerung derselben verbunden ist.“ K. Marx, Kapital III,
MEW 25, 303. „Sofern es zur
Abkürzung der Zirkulationszeit beiträgt, kann es indirekt den vom
industriellen Kapitalisten produzierten Mehrwert vermehren
helfen. Soweit es den Markt
ausdehnen hilft und die Teilung der Arbeit zwischen den Kapitalisten
vermittelt, also das gesellschaftliche Kapital befähigt, auf
größerer Stufenleiter zu arbeiten, befördert seine Funktion die
Produktivität des industriellen Kapitals und dessen
Akkumulation. Soweit es die
Umlaufszeit abkürzt, erhöht es das Verhältnis des Mehrwerts zum
vorgeschossenen Kapital, also die Profitrate. Soweit es einen geringeren Teil des Kapitals als Geldkapital in die Zirkulationssphäre einbannt, vermehrt es den direkt in der Produktion angewandten Teil des Kapitals.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 291.
Siehe auch die Artikel:
|
|
Zur
Zitierweise: Wo es dem Verständnis dient, wurden veraltete
Fremdwörter, alte Maßeinheiten und teilweise auch Zahlenbeispiele zum
Beispiel in Arbeitszeitberechnungen modernisiert und der Euro als
Währungseinheit verwendet. Dass es Karl Marx in Beispielrechnungen weder
auf absolute Größen noch auf Währungseinheiten ankam, darauf hatte er
selbst hingewiesen: „Die Zahlen mögen Millionen Mark, Franken oder Pfund
Sterling bedeuten.“ Kapital II, MEW 24, 396. Alle modernisierten Begriffe und Zahlen sowie erklärende Textteile, die nicht wörtlich von Karl Marx stammen, stehen in kursiver Schrift. Auslassungen im laufenden Text sind durch drei Auslassungspunkte kenntlich gemacht. Hervorhebungen von Karl Marx sind normal fett gedruckt. Die Rechtschreibung folgt der Dudenausgabe 2000. Quellenangaben verweisen auf die Marx-Engels-Werke, (MEW), Berlin 1956ff. |