|
2.2. Landwirtschaftliche Arbeit als Quelle der
Handwerks. Feld- und Hausarbeit bei Hesiod
Zu einer Zeit, als das
Wort „König“ im Griechischen einen politisch-herrschaftlichen Inhalt
bekommen hatte, soll Alexander der Große gesagt haben, Homer sei „der
Dichter für Könige, Hesiod einer für Bauern“ (Dion Chrysostomos
2,8.). Hesiod, der um 740 bis 670 v. Chr. lebte - eine oder zwei
Generationen nach Homer -,
wurde neben Homer zum antiken Schulbuchautor. Hängt bei Homer das
abenteuerliche Schicksal der Menschen von ihrer List und ihrem Kampfesmut
und ansonsten von den Göttern, bzw. den Naturgewalten ab, so gründen die
Bauern in Hesiods Lehrgedicht „Werke und Tage“ (Landarbeit und ihre
saisonalen Zeiten) ihr Glück eher auf gutes Sozialverhalten in einer
stabilen Gemeinschaft und auf eigene Arbeit.
Von den rund 825
Zeilen Hesiods beschreiben den Einfluss der Götter auf das Glück der
Menschen: rund 200 Zeilen. Am bekanntesten davon ist Hesiods Mythos vom
verschwundenen „goldene Zeitalter“, das nach einem silbernen und bronzenen
schließlich von dem „eisernen Zeitalter“ seiner Gegenwart abgelöst wurde:
Im goldenen Zeitalter aber lebten die Menschen „wie Götter,.... blieben
frei von Not und Jammer; nicht drückte sie schlimmes Alter...; sie ....
lebten heiter in Freuden ...von selbst trug ihnen die kornspendende Erde
Frucht in Hülle und Fülle. Sie aber taten ihre Feldarbeit nach Gefallen
und gemächlich und waren mit Gütern gesegnet.“ (Hesiod,
112f.).
Den Einfluss des Menschen auf sein eigenes Glück beschreibt
Hesiod mit rund 625 Zeilen. Der größte Raum wird dabei seinem
Sozialverhalten eingeräumt (400 Zeilen), dann folgt die Bedeutung der
eigenen Arbeit: 225 Zeilen. Innerhalb der Zeilen, die sich mit der
bäuerlichen Arbeit befassen, beschreiben die eigentliche Feldarbeit: 65
Zeilen, die Vorbereitung der Feldarbeit durch Geräteherstellung usw. 40
Zeilen, die Aufbereitung und Verwahrung der Feldfrüchte, Versorgung des
Viehs und der Menschen: 35 Zeilen. Größeren Raum nimmt auch ein Abschnitt
über die Seefahrt mit 85 Zeilen ein.
Ein guter Landwirt musste
nicht nur Boden, Pflanzen und Klima kennen, sondern auch ein guter
Werkzeugmacher und guter Verwalter der Ernte sein. Es gab einen
gewachsenen Kreislauf der Arbeiten auf dem Feld und der Arbeiten im Haus:
Herstellung von landwirtschaftlichem Gerät und von Essen und Kleidung als
Vorbereitung der Feldarbeit, Nutzung der Geräte auf dem Feld und
Nachbereitung und Lagerung der Ernte für den Konsum von Vieh und Menschen,
was gleichzeitig wieder auf die verschiedenen Arbeiten vorbereitete.
Hesiod berichtet davon, dass der Bauer in der landwirtschaftlichen
Vor- und Nachsaison seine Pflüge, Hammerstiele und einen Wagen und ein
Boot selber baut: „schickt
der machtvolle Zeus Herbstregen ..., da bleibt mit der Axt geschlagenes
Holz am ehesten wurmfrei...; da nun fälle das Holz und denke an
zeitgerechte Arbeit. Haue einen Mörser, drei Fuß hoch, die Keule drei
Ellen lang, sieben Fuß lang aber die Achse, denn so nur stimmen die Maße.
Hast du aber ein Achtfuß-Stück, hau dir noch einen Hammerstiel davon. Drei
Spannen im Durchmesser muss du das Rad für den zweieinhalb Fuß langen
Wagen hauen. Vieles Holz ist auch krumm; nimm gefundenes Krummholz zum
Pflug nach Hause, wenn du die Berge durchstöberst... eines aus Steineiche;
denn das hält beim Pflügen mit Rindern am meisten aus... Zwei Pflüge
stelle dir hin und baue sie sorgsam im Hause, einen von selbst gekrümmten
und einen gestückten... Bricht nämlich der eine, lässt du die Rinder den
anderen aufs Feld holen. Lorbeer- oder Ulmendeichseln sind vor Wurmfraß am
sichersten; der Scharbaum sei aus Eiche, aus Steineiche das
Krummholz.“ (Hesiod, 414ff.)
Zu anderen Zeiten pflügt, sät und
erntet dieser Handwerkerbauer oder bäuerliche Handwerker, schneidet die
Weinstöcke und sorgt für den Winter vor. Erst aus diesem saisonalen
Nacheinander wechselnder bäuerlicher und handwerklicher Arbeiten derselben
Person entstand das Nebeneinander verschiedener Arbeit verschiedener
Personen, so vertiefte sich die Arbeitsteilung zu einer Trennung von Bauer
und Handwerker.
Die früheste Arbeitsteilung hatte sich zwischen
Frauen und Männer entwickelt: Die Frauen arbeiteten im Umkreis von Haus
und Hof. Sie spannen und webten, versorgten Vieh und Gemüsegarten und
kochten das Essen. Die Männer arbeiteten auf dem Feld, gingen in die
Volksversammlung, fuhren zur See und zogen in den Krieg. Nun wurde die
landwirtschaftliche Arbeit der Männer weiter aufgeteilt. Als die ältesten
nichtlandwirtschaftlichen Berufe sind der Schmied und der Zimmermann
etymologisch bei den Griechen nachweisbar. Als Waffenschmied war der
Schmied den Griechen so wichtig, dass sie ihn in der Gestalt des hinkenden
Hephaistos zum Gott erhoben. Diese Auszeichnung gaben sie dem Zimmermann
nicht. Dessen technische Fertigkeiten beherrschte ursprünglich jeder
Bauer, später noch jeder geschickte Bauer: „Meint ein Siebengescheiter:
‚Ich baue mir leicht einen Wagen‘, ist er ein Tor, der nichts davon
versteht, denn es gibt hundert Hölzer für Wagen, die man vorher beschaffen
und im Haus bereitlegen muss.“ (Hesiod, 453ff.). Das Ansehen des
Zimmermanns litt wohl auch darunter, dass er zunächst nur die schwersten
Vorbereitungsarbeiten beim Haus- und Schiffsbau erledigte, der eigentliche
Bau blieb noch in Händen des Bauern. Dieser Handwerker war zunächst nur
ein Hilfsarbeiter: „... und der Zimmermann haue die Balken zum Gemach,
dazu viele Bootshölzer, die zum Schiffbau taugen. Am vierten Tag aber
beginne den Bau schlanker Schiffe.“ (Hesiod, 805f.)
Ganz
anders der frühe Schmied, dem göttliche Fähigkeiten zugetraut wurden. Der
Schmied war anfangs nur ein Gold- und Silberschmied, der neben Kleingerät
auch Schmuck herstellte. Später schied sich der Grobschmied, der mit
Bronze und später mit Eisen Waffen und Gerät herstellte, vom Feinschmied,
der weiter mit Gold und Silber arbeitete. Ebenso teilten sich allmählich
die Tätigkeiten des Zimmermanns in Stellmacher (Wagenmacher) und
Bootsbauer.
Genau wie bei der Arbeitsteilung zwischen Mann und
Frau blieb auch zwischen Bauern, Schmied und Zimmermann das Zusammenwirken
der Menschen in ihren Tätigkeiten durchsichtig und überschaubar:
Bauersfrau und Bauersmann arbeiteten für sich und ihre Familie, der
Zimmermann arbeitete für die Bauern. Der Schmied arbeitete für den Bauern,
wenn er eisernes Gerät schuf, und er arbeitete für die Gemeinschaft, wenn
er Waffen und Rüstungen zum Schutz oder für einen Beutezug schmiedete.
Gleichzeitig hatten die Bauern für Schmied und Zimmermann gearbeitet, wenn
sie die Handwerker mit Essen und Kleidung entlohnten. Alle Beteiligten
arbeiteten für ihnen bekannte Menschen, nicht für einen Markt mit anonymen
Abnehmern. Soweit diese Produktion für einen vorher überschaubaren Bedarf
von bekannten Personen bestimmt war, wurden nur Gebrauchswerte
hergestellt, keine Waren. Und weil alle wirtschaftlichen Beziehungen noch
persönliche Beziehungen waren und keine anonymen Geldbeziehungen, legte
Hesiod auch soviel Wert auf die richtigen Umgangsformen miteinander. Hing
der Erfolg des Landwirts abgesehen vom Boden und vom Klima ab von der
Mithilfe familiärer und außerfamiliärer Arbeitskräfte ab, so der Erfolg
des Handwerkers - abgesehen von seinem eigenen Arbeitsgeschick - von
seinem guten Verhältnis zu den Kunden. Das ist der soziale Boden für die
Weisheitslehren des Hesiods, die den Großteil seines Lehrgedichts
ausmachen.
Solange die Bauern für sich selbst und ihre
Mitwirkenden unter den Bauern und Handwerkern produzieren und nicht für
einen anonymen Markt, solange gibt es unter ihnen zwar ein Wettstreit, wo
mit dem eigenen Reichtum geprunkt wird, aber keine antagonistische
Konkurrenz, wo der Erfolg des einen der Misserfolg des anderen ist. Anders
für die Handwerker, die für eine begrenzte Nachfrage arbeiten. Für sie
schafft die Beschäftigung des einen Mangel an Beschäftigung für den
anderen. Daher sagt Hesiod über sie: „und so grollt der Töpfer dem
Töpfer und der Zimmermann dem Zimmermann, der Bettler neidet dem Bettler,
und der Sänger dem Sänger.“ (Hesiod, Werke und Tage
25-26.)
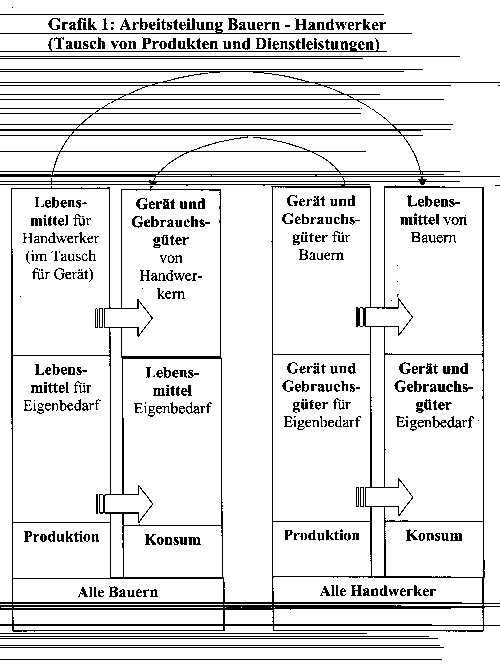
Wird
fortgesetzt, Wal Buchenberg |